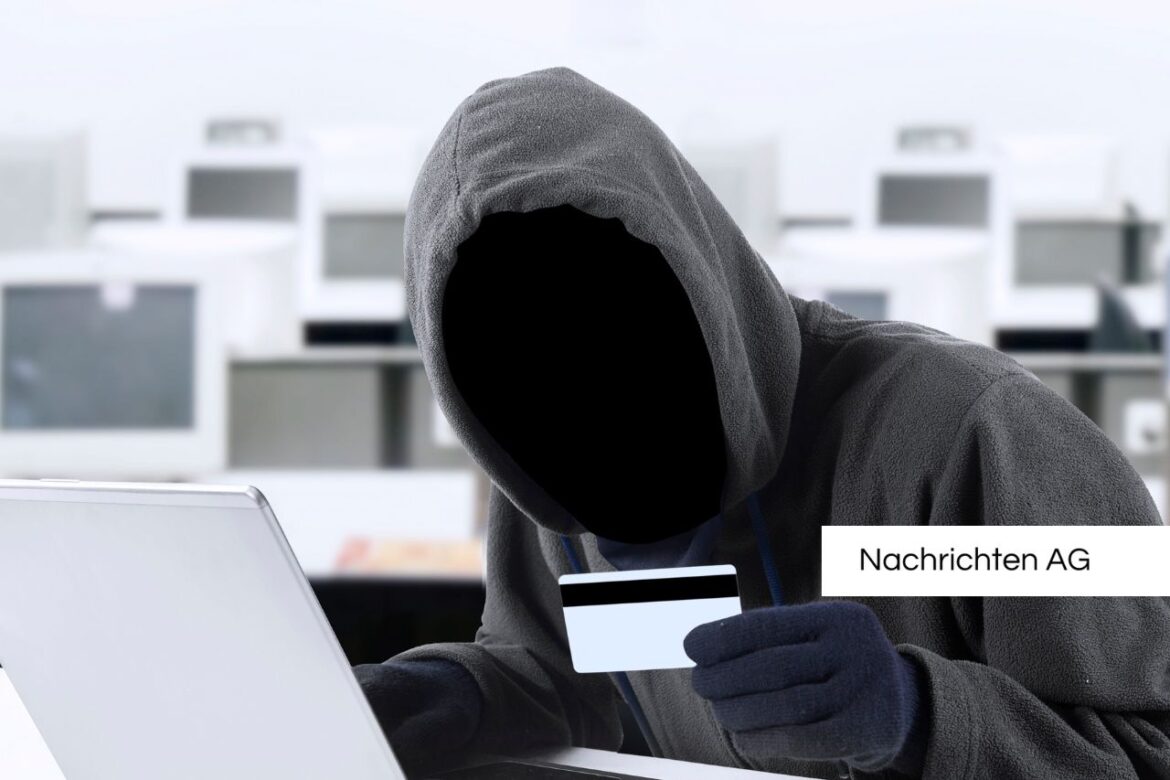Die aktuelle Forschung des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen offenbart einen signifikanten Rückgang des Niedriglohnrisikos in Deutschland. Laut der neuesten Auswertung von Dr. Thorsten Kalina sank der Anteil der Beschäftigten, die von Niedriglöhnen betroffen waren, zwischen 2021 und 2022 um fast zwei Prozentpunkte auf 19%. Diese Entwicklung wird vor allem durch die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro im Jahr 2022 begünstigt.
Besonders in Westdeutschland ist ein deutlicher Rückgang des Niedriglohnrisikos zu verzeichnen, das von 19,9% auf 17,9% fiel. Die Datenerhebung zeigt, dass der Höchststand der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland zwischen 2009 und 2011 bei rund 24% lag. Dies markiert den ersten Rückgang der Niedriglohnbeschäftigung seit 2018, als der Wert bei 21,2% lag. Die gesamtdeutsche Niedriglohnquote verringerte sich von 20,9% auf 19% zwischen 2021 und 2022, wobei auch migrantische Beschäftigte und befristet Angestellte von dieser positiven Entwicklung profitierten.
Ungleichheiten und Herausforderungen
Trotz der erfreulichen Rückgänge zeigen sich zwischen verschiedenen Gruppen unterschiedliche Entwicklungen. Geringqualifizierte, Frauen, Jüngere, Ältere sowie Minijobber:innen erlebten einen unterdurchschnittlichen Rückgang des Niedriglohnrisikos. Im Gegensatz dazu konnten Hochqualifizierte, Männer und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von überdurchschnittlichen Rückgängen profitieren. Dies gibt Anlass zur Diskussion über die Notwendigkeit einer erneuten Erhöhung des Mindestlohns, die möglicherweise nicht den gewünschten Effekt auf die Verkleinerung des Niedriglohnsektors haben könnte.
Ein zentraler Punkt, den Arbeitsmarktforscher anmerken, ist der Einfluss der Tarifbindung auf die Niedriglohnbeschäftigung. Diese könnte wesentlich stärker wirken als die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns. Daher plädieren Fachleute für eine Ausweitung der Tarifbindung als Mittel zur Verringerung des Niedriglohnsektors.
Aktuelle Niedriglohnquote und Branchenanalyse
Zusätzliche Informationen zur Niedriglohnquote stammen von den Statistischen Ämtern. Für das Jahr 2023 lag der Anteil der Beschäftigungsverhältnisse mit weniger als zwei Dritteln des mittleren Verdienstes bei 16%, was einen Rückgang im Vergleich zu 2018 darstellt, als der Anteil 21% betrug. Besonders auffällig ist der hohe Niedriglohnanteil im Gastgewerbe, der bei 51% liegt.
Die Verteilung von Niedriglöhnen ist unterschiedlich nach Geschlecht und Alter: 19% der Frauen und 13% der Männer erhalten Niedriglöhne, während 40% der unter 25-Jährigen und 37% der über 65-Jährigen betroffen sind. Auch der Bildungsabschluss spielt eine entscheidende Rolle: 37% der Beschäftigten ohne Berufsausbildung erhalten Niedriglöhne, während der Anteil bei Hochschulabsolventen nur 6% beträgt. Diese Zahlen verdeutlichen die Herausforderungen, die im deutschen Arbeitsmarkt bestehen, und die Notwendigkeit, gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung von Niedriglöhnen zu ergreifen.
Für weitere Informationen zur Niedriglohnforschung und ihren Ergebnissen besuchen Sie bitte die Webseite des IAQ. Detaillierte Berichte und Daten sind auch bei Sozialpolitik Aktuell und den Statistischen Ämtern erhältlich.