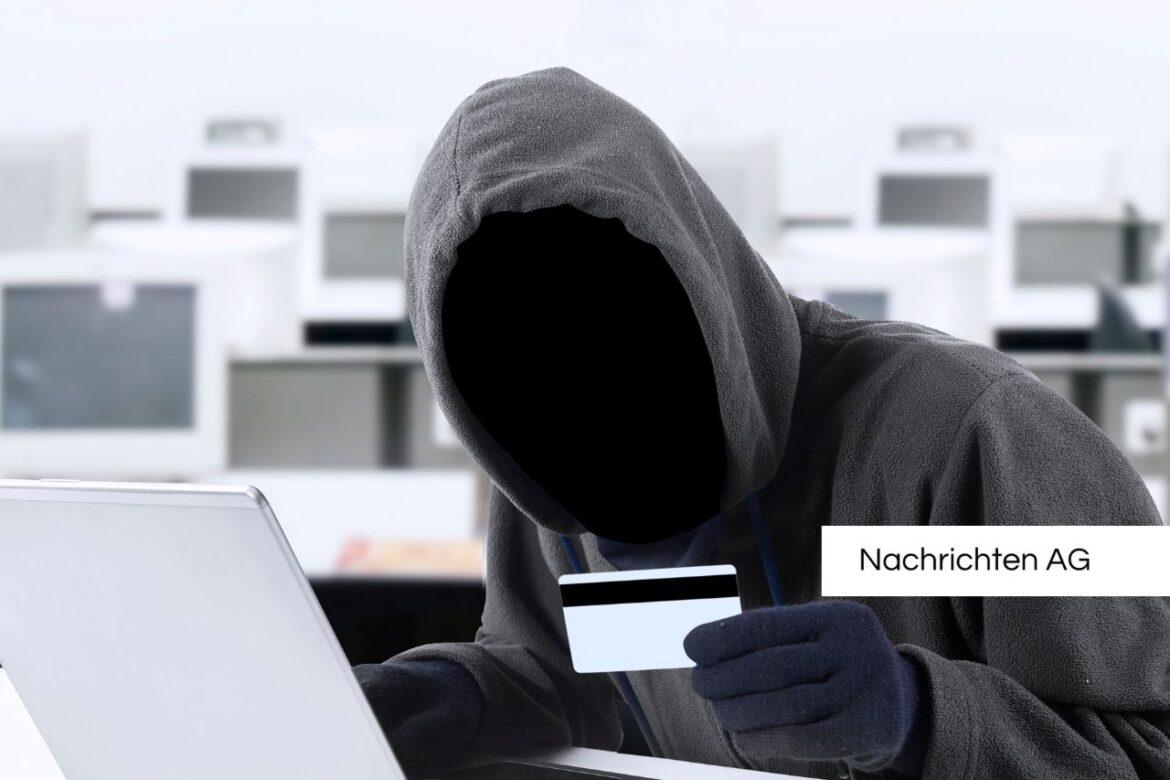Dr. Daniel Krieger vom Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg hat ein bahnbrechendes Modell zur Vorhersage von Sturmfluten entwickelt. Die Studie, veröffentlicht im Fachmagazin Geophysical Research Letters, zeigt, dass moderne Technologien, wie künstliche Intelligenz, in Verbindung mit traditionellen Klimamodellen und Wetterdaten eine präzisere Vorhersage von Sturmfluten ermöglichen. Die Testergebnisse des Modells beziehen sich auf die nächsten zehn Jahre und umfassen Städte an der Nordsee wie Cuxhaven, Esbjerg in Dänemark und Delfzijl in den Niederlanden.
In den letzten zehn Jahren wurden in Cuxhaven durchschnittlich 11,6 Sturmfluten pro Jahr registriert. Das neue Modell prognostiziert für denselben Zeitraum 12,8 Sturmfluten jährlich, wobei ein Toleranzbereich von 1,6 Sturmfluten berücksichtigt wird. Für die Jahre bis 2029 erwartet das Modell einen stabilen Wert von 12 Sturmfluten pro Jahr. Diese Informationen sind von entscheidender Bedeutung für den Küstenschutz, insbesondere für Deichbauten und die Verbesserung der Hafeninfrastruktur.
Ein Blick auf die Sturmfluten
Die höchste jährliche Sturmflut in den letzten zehn Jahren betrug im Durchschnitt 2,5 Meter. Interessanterweise zeigt das Modell für die kommenden fünf Jahre eine durchschnittliche Sturmfluthöhe von drei Metern an. Vorherige Klimamodelle waren zwar hilfreich, konnten jedoch nur die Häufigkeit von Stürmen in der Nordsee berechnen, jedoch nicht die spezifischen Auswirkungen an bestimmten Küstenorten.
Um die Prognose zu erstellen, basierte die Analyse auf insgesamt etwa 700.000 stündlich gemessenen Wasserständen, die seit 1940 in Cuxhaven dokumentiert wurden. Das statistische Modell lernte aus 80% dieser Daten, während die restlichen 20% zur Validierung genutzt wurden. Beeindruckend ist die Geschwindigkeit, mit der das Modell arbeitet: Die Berechnung einer Prognose dauert nur etwa eine Sekunde, was es deutlich effizienter macht als traditionelle Klimamodelle.
Küstenschutz im Fokus
Der Klimawandel hat weitreichende Folgen für die Küstenregionen. Laut Luftfahrt und Umweltforschung Hannover ist der Anstieg des Meeresspiegels eine der größten Herausforderungen für den Küstenschutz. Historisch gesehen haben Menschen entlang der Küsten stets versucht, sich vor den Einwirkungen des Meeres zu schützen und gleichzeitig dessen Ressourcen zu nutzen. Die Vorträge und Studien zu den aktuellen Entwicklungen im Küstenraum zeigen, dass es notwendig ist, sowohl das Lebensumfeld als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an den Küstenräumen zu erhalten.
In diesem Zusammenhang wird ein Paradigmenwechsel im Küstenschutz diskutiert, der Lösungsansätze und Strategien zur Anpassung an die fortschreitenden Veränderungen beinhaltet. Die Ringvorlesung thematisiert auch die Rolle der „Blue Economy“, die als schnell wachsender Wirtschaftszweig gilt und den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere und Küstenräume fördert.
Der Druck des Klimawandels
Das Umweltbundesamt hebt hervor, dass die klimapolitischen Herausforderungen und der Meeresspiegelanstieg für die Küstenregionen in Deutschland weitreichende physische und ökologische Konsequenzen haben. So nimmt die Gefahr von Überschwemmungen, insbesondere in küstennahen Gebieten, zu. Diese Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit einer mittleren Erwärmung der Wasseroberfläche der Nordsee von 0,26 °C pro Dekade und der Intensität seltener Sturmfluten.
Die Küstenregionen, die soziokulturell, ökologisch und ökonomisch bedeutend sind, benötigen integrierte Küstenmanagementstrategien, um den ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen gewachsen zu sein. Die Notwendigkeit robuster Handlungsoptionen wird durch die veränderte Meeresnutzung und die steigenden Risiken durch den Klimawandel deutlich, was weitere Forschungen und innovative Lösungen erfordert.